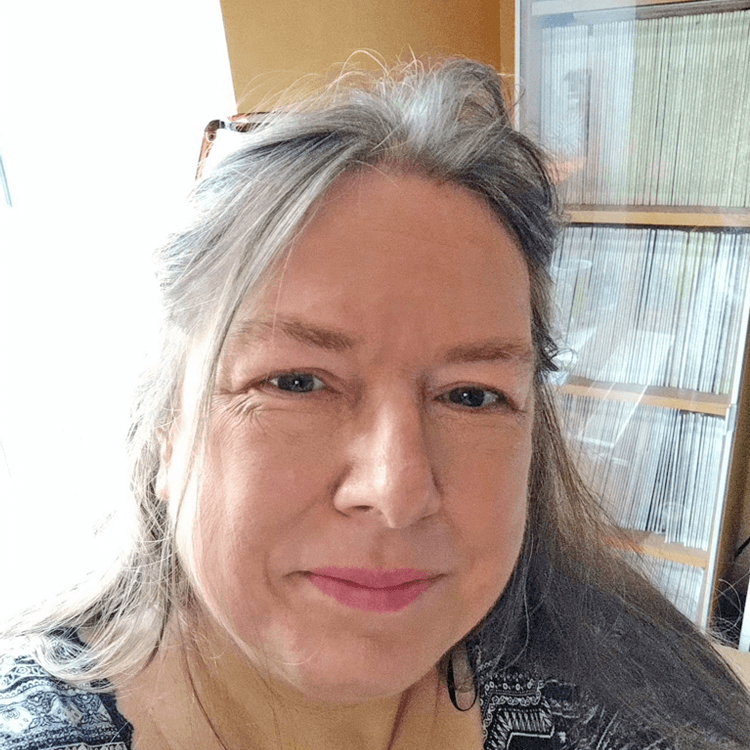Autos zu Hause laden? – Das ist heute kein Problem. Aber lohnt sich ein Elektroauto ohne Photovoltaik? (Foto: Zaptec, Unsplash)
Den Rasen mit Solarenergie mähen und gleichzeitig bequem das E-Auto zu Hause laden – so nutzt du deine PV-Anlage für den heimischen Strombedarf und zugleich für deine emissionsarme Mobilität. Doch was, wenn du gar keine PV-Anlage und somit keine Wallbox zu Hause hast? E-Auto-Besitzer:innen fragen sich: Lohnt sich ein E-Auto ohne Photovoltaik überhaupt?
Lohnt sich ein E-Auto ohne Photovoltaik? Das Wichtigste kurz gefasst
- Trotz anhaltend hoher Strompreise sind Elektroautos immer noch eine der günstigsten Fortbewegungsarten.
- Ein E-Auto zu laden lohnt sich mit Photovoltaik auf dem eigenen Dach erst richtig.
- Auch die Solaranlage wird durch die Kombination mit Elektromobilität rentabler.
- Dank bidirektionalem Laden kann das Elektroauto zum heimischen Stromspeicher werden.
- In 2024 gibt es für E-Auto-Besitzer:innen immer noch regionale Förderungen für eine Wallbox zu Hause.
Warum ist die Kombination aus E-Auto und Solardach so vorteilhaft?
Keine Frage: Elektromobilität liegt im Trend. Anfang 2023 fuhren bereits eine Million in Deutschland zugelassene Elektroautos auf den Straßen. Ende 2023 listete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sogar mehr als 1,4 Millionen ausschließlich per elektrischem Strom betriebene Fahrzeuge – sogenannte „Battery Electric Vehicles“ (BEV). Eine Steigerung um fast mehr als 40 Prozent. Auch die Neuzulassungen bei Hybridfahrzeugen sind im selben Zeitraum gestiegen: Laut KBA waren Ende 2023 mehr als 2,9 Millionen Hybridfahrzeuge in Deutschland zugelassen – 24,5 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.
Zu verdanken war das vor allem der Bundesförderung für E-Autos (Umweltbonus) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Dadurch war der Erwerb – ob Kauf oder Leasing – eines E-Autos bis zu einem Netto-Listenpreis des Basismodells von 65.000 Euro mit bis zu 6.750 Euro förderfähig (unter der Bedingung einer Mindesthaltedauer von 12 Monaten, bei Leasingfahrzeugen je nach Laufzeit zwischen 12 und 24 Monaten). Für den Kauf von jungen gebrauchten E-Autos (Jahreswagen) gab es einen Zuschuss von 3.000 Euro. Hinzu kam der herstellerseitige Innovationszuschuss in derselben Höhe. Schon seit Anfang 2023 sind allerdings Plug-in-Hybridfahrzeuge nicht mehr im Förderrahmen Elektromobilität der Bundesregierung enthalten.
Was kostet es, ein E-Auto zu Hause zu laden?
Bei den anhaltend hohen Strompreisen stellt sich jedoch die Frage: Was kostet es, ein E-Auto zu Hause zu laden? Immerhin finden die meisten Ladevorgänge daheim statt. Werfen wir einen Blick auf die Zahlen:
| Reichweite | 100 km |
| Ladezeit | ca. 5 Stunden |
| Benötigte kWh | 15 |
| Preis pro kWh für Neukunden | rund 26 Cent |
| Preis pro kWh für Bestandskunden | rund 37 Cent |
| E-Auto zu Hause laden Kosten * | 3,90 bis 5,55 Euro |
* Ohne einen speziellen Autostromtarif für das Zu-Hause-Laden von E-Autos, der von immer mehr Energieunternehmen angeboten wird.
Zum Vergleich: Eine Tankfüllung Benzin für 100 km kostet bei einem Preis von 1,80 Euro für 1 Liter Super E10 und einem Verbrauch von 8 Litern 14,40 Euro. Bei einem Diesel wären es beim derzeitigen Dieselpreis von 1,65 Euro/Liter 13,20 Euro.
Mit einer PV-Lösung auf dem Dach und einem E-Auto in der Garage hast du gut lachen, denn mit der Wallbox für zu Hause betankst du den Stromer quasi umsonst. Wenn du dazu die Tagesstunden mit der größten Stromausbeute nutzt, rentiert sich das Solardach besonders schnell. Statt die überschüssigen kW (Kilowatt) Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen und dafür die Einspeisevergütung von aktuell 8,11 Cent/Kilowattstunde (kWh) für teileinspeisende Anlagen bis 10 kW Ladeleistung zu erhalten, profitierst du selbst vom Sonnenstrom. Das rechnet sich, da du für eine kWh zugekauften Strom fast 40 Cent zahlen musst.
Wie viel Solar, um ein E-Auto zu laden? Experten raten zu einer rund 15 Quadratmeter größeren Anlage mit einem Plus von 2,5 kWp Photovoltaik.
Und noch einen Vorteil bietet die Kombi E-Auto und Solardach: Wenn dein E-Auto fürs bidirektionale Laden ausgelegt ist, lässt es sich sogar als Stromspeicher nutzen. Dann speicherst du den produzierten Strom in der Autobatterie zwischen und kannst ihn für deinen nächtlichen Strombedarf nutzen, statt Strom zukaufen zu müssen. Man spricht dann von Anwendungen wie V2H (Vehicle to Home), V2L (Vehicle to Load) oder gar V2G (Vehicle to Grid).

Fahrender Stromspeicher: Neue E-Autos ermöglichen mit bidirektionalem Laden den Austausch von Strom. (Foto: senivpetro, Freepik)
So kannst du am Abend mit dem tagsüber ins Elektroauto geladenen Solarstrom deiner Photovoltaikanlage deine Haushaltsgeräte kostengünstig mit Strom versorgen. Das trägt laut Thorsten Zoerner, Geschäftsführer und CTO der Stromdao GmbH und Experte in Sachen Solarstrom, auch dazu bei, Spitzenlasten zu vermeiden, die den Preis des Netzstroms erhöhen. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene können seiner Meinung nach heimische PV-Anlagen helfen, die Aktivierung von Gaskraftwerken zu vermeiden.
Bei der Vehicle-to-Grid-Technologie soll es bald möglich sein, den Puffer in den Akkus der E-Autos zurück ins Stromnetz abzugeben, um Lastspitzen auszugleichen. Dies bietet Netzbetreibern eine effiziente Netzsteuerung und E-Auto-Besitzer:innen zusätzliche Verdienstmöglichkeiten.
Wie lässt sich mit Strom das E-Auto zu Hause laden?
Und wie kann ich mein E-Auto zu Hause laden? In die Garage fahren, eine Steckdose finden und ein Verlängerungskabel mit dem E-Auto verbinden: Selbst auf diese Weise gelingt es, ein E-Auto zu Hause zu laden. Soll es noch nachhaltiger sein? Strom aus erneuerbaren Quellen kannst du daheim fürs E-Auto nutzen, wenn du eine Solardachlösung auf dem Haus hast – entweder als Aufdachanlage oder als Solardachziegel – und damit autark mobil bleiben. Wir zeigen dir alle Lademöglichkeiten für dein E-Auto.
A: E-Auto laden mit AC-Wechselstrom (Schuko-Steckdose)
Wer sich für die kostengünstige Variante entscheidet, sein E-Auto von der Steckdose (Schuko) mit Strom zu versorgen, muss meist mit langen Ladezeiten rechnen. Das Laden des E-Autos per Verlängerungskabel erfolgt mit Wechselstrom (AC-Laden). Der Wechselstrom aus der Steckdose mit 2,3 kW Ladeleistung muss erst vom Gleichrichter des E-Autos in Gleichstrom umgewandelt werden.
Die AC-Ladung ist zwar langsam, kann aber problemlos mit jedem Elektroauto vorgenommen werden, was bei einer Gleichstrom-Ladung (DC-Laden) nicht der Fall ist. Dieses Normalladen oder „Notladen“ kann bei einem Mittelklassefahrzeug mit einer Batterie von 50 kWh für eine Reichweite von 100 Kilometern fast 8 Stunden dauern. Für eine komplette Ladung an einer Schukosteckdose musst du je nach Akku mit einer Ladezeit zwischen 12 und 24 Stunden rechnen.
Die meisten Autofahrer:innen legen circa 40 Kilometer am Tag zurück, sodass diese Ladelösung von daheim unpraktikabel ist, vor allem für die Lebensdauer der Batterie und mögliche Ladeverluste. Kaum jemand hat die Muße, zwischen zwei Terminen die Batterie seines E-Autos mit einer nur geringen Akkuladung an öffentlichen Ladestationen aufzuladen. Das E-Auto zu Hause per Steckdose zu laden, ist höchstens für den gelegentlich benutzten Zweitwagen geeignet.
B. E-Auto mit der Ladestation oder Wallbox laden
Mit einer Wallbox zu Hause kannst du die Ladezeit deines E-Autos um mindestens 3 bis 4 Stunden reduzieren. Bei 11 kW Ladeleistung lädst du ein Fahrzeug mit einer Batteriekapazität von 50 kWh mehr als doppelt so schnell auf. Die Ladezeit für eine Reichweite von 100 Kilometern reduziert sich – im Vergleich zum Laden von der Steckdose – von 8 auf 1,5 Stunden.

Die Wallbox für zu Hause: Mit Energiemanagement an Bord eine gute Lösung, um die Ladezeit von E-Autos zu reduzieren. (Foto: Zaptec, Unsplash)
Bevor du dir eine Ladesäule oder Wallbox zu Hause anschaffst, solltest du immer eine Fachberatung zurate ziehen. Zum Preis für das Wandladegerät addieren sich die Montagekosten. Die fachgerechte Installation einer Ladesäule kann zwischen 1.000 und 5.000 Euro kosten. Eine gute Übersicht über technische Daten von E-Fahrzeugen und ihre Eignung für verschiedene Ladesäulen bietet die EV-Database.
Checke vor dem Kauf, ob die Wallbox für zu Hause eine bequeme Bedienung per App ermöglicht und einen DC-Fehlerstromschutz integriert hat. Wallboxen unterscheiden sich hinsichtlich folgender Punkte:
- Ladeleistung (11, 22 oder 44 kW)
- Ausstattung
- Steckertypen
- Bedienkomfort
- Konnektivität
Eine 22-kW-Wallbox lädt doppelt so schnell wie eine Wallbox mit 11 kW Ladeleistung, vorausgesetzt, dass dein E-Auto ein Ladesystem hat, das diese höhere Leistung aufnehmen kann. Achtung: Wallboxen mit 22 kW Ladeleistung müssen vor dem Start durch den Netzbetreiber genehmigt werden.
So manche Wallbox kommt mit dem passenden Kabel, andere Modelle bieten nur eine Typ-2-Ladebuchse an. Stationäre Wallboxen werden fest montiert – meist in der Garage eines Ein- oder Mehrfamilienhauses. Eine mobile Wallbox kann auf Reisen in deinem E-Auto mitgenommen werden. Es gibt auch Modelle, die alles in einem anbieten: Eine heimische Ladelösung an der Wand, für unterwegs bis hin zum separaten Mode-3-Kabel zum zuverlässigen Laden an öffentlichen Ladestationen.
Die angegebene Leistung einer Ladestation bezieht sich in der Regel auf eine dreiphasige Ladung. Manche E-Fahrzeuge besitzen jedoch nur einen einphasigen Laderegler. Dann fließt nur ein Drittel der Nennleistung in die Batterie des E-Autos.
Einige Wallbox-Modelle bieten eine digitale Schnittstelle für das einfache Verbinden der Wallbox mit einem Energiemanagementsystem. Diese Softwaretechnik dient dem effizienten Zusammenspiel der Solardachanlage mit der Ladestation des Autos und der Nutzung von Solarstrom im Haus.
Übrigens: Mit einer DC-Wallbox lässt sich das E-Auto zu Hause mit Gleichstrom laden. So eine Wallbox ist für das bidirektionale Laden unerlässlich.

Das junge Mainzer Unternehmen Ambibox hat mit der 11-kW-DC-Wallbox ein Gleichstrom-Ladegerät für alle entwickelt. Damit können Elektroautos bis zu fünfmal schneller als an einer herkömmlichen Steckdose geladen werden. (Foto: Ambibox)
C. E-Auto mit Strom vom Solardach laden
Ein über die heimische Wallbox geladenes E-Auto macht Solardächer erst richtig effizient, denn Eigenverbrauch ist wirtschaftlich viel interessanter als Netzeinspeisung. Dein E-Auto zu Hause zu laden erhöht die Rentabilität deiner PV-Anlage erheblich. Allerdings muss zuvor einiges in die Technik daheim investiert werden, damit
- das Energiemanagement,
- die Größe der PV-Anlage und
- die Ladetechnik des E-Autos effektiv zusammenpassen.
Viele Menschen fragen sich bei der derzeitigen Strom- und Kraftstoffpreisentwicklung, ob die Installation einer PV-Anlage allein zum Laden eines E-Autos bereits Sinn macht. Tatsächlich lohnt sich die PV-Lösung bereits für die E-Mobilität. Allerdings funktioniert das direkte Laden des E-Autos vom Solardach erst bei einem PV-Stromüberschuss von 6 Ampere beziehungsweise 1,4 kW bei einem einphasig ladenden E-Auto. Lädt dein E-Auto dreiphasig, müssen mindestens 4,2 kW an Stromleistung für die Batterie da sein. Bei kleineren Anlagen bis 10 Kilowattpeak (kWp) bedeutet dies, dass nur ein sehr enges Zeitfenster zum Laden da ist.
Hier kann eine Wallbox mit einer automatischen Phasenumschaltung helfen, die je nach realer PV-Leistung zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden wechselt. Damit können die Zeitfenster bei wechselhaftem Wetter oder in den Randzeiten deutlich verbessert werden, um das E-Auto zu Hause zu laden.
Da die Anschaffungskosten einer 10-kWp-PV-Anlage ohne Speicher bei mindestens 1.300 Euro pro kWp liegen und ein E-Auto bei einer Fahrleistung von ca. 10.000 Kilometern pro Jahr rund 2.000 kWh verbraucht, lohnt sich der genaue Blick auf die Zahlen.
Ein Beispiel:
- Ein Haushalt mit zwei Personen verbraucht im Durchschnitt 4.000 kWh.
- Eine PV-Anlage mit 10 kWp Leistung liefert rund 8.000 kWh im Jahr.
Für die nicht selbst verbrauchten 4.000 kWh bekommen Solarenergieerzeuger:innen momentan eine Einspeisevergütung von 8,11 Cent pro Kilowattstunde. Das ergibt 324,40 Euro pro Jahr für den eingespeisten Solarstrom.
Betankst du dein E-Auto aus Netzstrom über die Wallbox zu Hause, musst du mit mindestens 30 Cent/kWh rechnen, an öffentlichen Ladestationen sogar mit rund 40 Cent/kWh. Verwendest du die überschüssigen 4.000 kWh, um dein E-Auto zu Hause zu laden, sparst du 1.200 bis 1.600 Euro an Stromkosten ein. Davon musst du allerdings noch die Stromgestehungskosten abziehen, die für die Umwandlung von Solarenergie in elektrischen Strom entstehen. Bei einer PV-Anlage ohne Speicher liegen diese laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) zwischen 5 und 11 Cent pro kWh, also bei 200 bis 440 Euro im Jahr. Damit liegt die Einspeisevergütung je nach Anlage sogar unter den Stromgestehungskosten.
Ein gutes PV-Energiemanagementsystem sorgt für mehr Effizienz der heimischen Solarlösung:
- Der Eigenverbrauch an Solarstrom kann um 10 bis 20 Prozent gesteigert werden.
- Weil das System den Ladevorgang des E-Autos steuert, werden Ertragsspitzen optimal genutzt. Das E-Auto direkt zu laden ist besser, als den Strom zwischenzuspeichern. Stromspeicher sind kostspielig (ca. 1.000 Euro/kWh) und verursachen Ladungsverluste (Wirkungsgrad circa 90 Prozent).
- Ein PV-Energiemanagementsystem in Kombination mit einem Batteriespeicher ist noch effizienter und macht bidirektionales Laden möglich.
E-Auto zu Hause laden in der Mietwohnung
Auch ohne Eigenheim oder Garage: Wir verraten dir, wie du dein E-Auto in der Mietwohnung laden kannst:
- Über eine Steckdose: Liegt die Wohnung nicht zu hoch und der Parkplatz nah am Haus, kannst du das E-Auto über eine normale Steckdose laden.
- Wallbox am gemieteten Stellplatz: Wenn zur Wohnung ein gemieteter Stellplatz gehört, kannst du deine:n Vermieter:in um Erlaubnis zur Installation einer Wallbox oder eines Ladepunkts bitten. Die Erlaubnis sollte schriftlich erfolgen.
- An einem öffentlichen Ladepunkt: Immer mehr öffentliche Ladepunkte ermöglichen es Mieter:innen in Städten, ihr Elektroauto auch ohne eigene Wallbox zu laden.
Die richtige Ladestrategie des E-Autos ist entscheidend
An öffentlichen Ladesäulen musst du mit Strompreisen zwischen 40 Cent und 80 Cent pro kWh rechnen. Der „Emobility Excellence Report 2023“ von Auto Bild hat errechnet, dass E-Fahrer:innen beim Laden unterwegs um 140 Prozent teurer fahren als über die Wallbox zu Hause. Das gilt umso mehr, wenn der Strom vom eigenen Dach kommt.
Berufspendler:innen brauchen eine möglichst große Batterie im E-Auto. Das bedeutet aber auch lange Ladezeiten. Hier lohnt sich eine Solardachlösung mit heimischer Wallbox richtig, denn so kannst du das Auto besonders günstig und bequem laden. Dabei solltest du bereits bei der Planung der PV-Lösung auf die richtige Dimension der Anlage achten. Ebenfalls wichtig sind:- Ausrichtung der Solardachanlage
- Dachneigung
- Andere ertragsbeeinflussende Faktoren
Dauert der Ladevorgang lange oder willst du auch im Winter den eigenen Solarstrom tanken, lohnt sich die Investition in einen Stromspeicher.
Werden E-Autos und Ladestationen in 2024 gefördert?
Der Umweltbonus hat 2023 die Nachfrage nach E-Autos gesteigert, und Zuschüsse für Wallboxen ergänzen die Förderlandschaft regional. Wie sieht es 2024 mit Förderungen für E-Autos aus?
Zu wenig Schnellladepunkte und öffentliche Ladestationen für Elektroautos in Deutschland: Zugelassen sind in Deutschland mehr als zwei Millionen E-Autos, über die Hälfte davon wird vollelektrisch betrieben. (Foto: Molgreen, Wikimedia Commons)
E-Auto in 2024 – leere Fördertöpfe, verunsicherte Autokäufer:innen
Leider kam das Aus für das KfW-Programm bereits am 18. Dezember 2023 – mit spürbaren Folgen für den Neuwagenmarkt. Die Branche reagierte geschockt, als der BAfA-Zuschuss für preiswerte E-Autos sogar rückwirkend gesenkt wurde:
| Elektrische Neufahrzeuge unter 40.000 Euro Netto-Listenpreis | Elektrische Neufahrzeuge über 40.000 Euro Netto-Listenpreis | |
| Förderung alt | 6.000 Euro | 6.750 Euro |
| Förderung neu | 4.500 Euro | 3.000 Euro |
Bereits im Januar 2024 zeigte sich ein Rückgang der BEV-Neuzulassungen: Nur noch 12,6 Prozent aller Neuzulassungen sind E-Autos. Im gleichen Zeitraum stieg die Nachfrage nach Pkws mit Benzin- und Dieselantrieb.
Auch im Bereich der Photovoltaikförderung herrscht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Unsicherheit in der Bevölkerung. Investitionen in die eigene PV-Lösung werden zurückgestellt. Da fragen sich viele: Lohnt sich ein E-Auto ohne Photovoltaik? Tatsächlich fährst du auf lange Sicht selbst dann mit einem E-Auto günstiger, wenn du den Strom dafür aus dem Netz beziehen musst. So richtig sparen kannst du erst, wenn du zum E-Auto auch noch eine Solaranlage und eine Wallbox zu Hause installierst.
Abrechnung E-Auto Laden zu Hause: Beim Elektrodienstwagen kannst du die heimischen Ladekosten über eine monatliche Pauschale geltend machen und musst keine gesonderten Aufzeichnungen führen. Bis 2030 sind folgende Beträge anzusetzen:
| Elektroautos | Hybridautos | |
| Pauschale ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber | 70 Euro im Monat | 35 Euro im Monat |
| Pauschale mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber | 30 Euro im Monat | 15 Euro im Monat |
Steuerfrei ist der Ladestrom für Elektro- oder Hybridfahrzeuge übrigens, wenn du dein Elektroauto – egal, ob dein Privatwagen oder ein Firmenfahrzeug – bei dem:der Arbeitgeber:in auflädst und diese:r dir die Stromkosten als Bonus zu deinem Arbeitslohn gewährt.
Keine Neuauflage der KfW-Förderung von E-Wallboxen
Unterwegs müssen E-Auto-Besitzer:innen meist auf die vergleichsweise teuren öffentlichen Ladestationen zurückgreifen. Das öffentliche Ladenetz ist inzwischen recht gut ausgebaut. Das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur listete Stand 1. November 2023
- 93.261 Normalladepunkte,
- 22.047 Schnellladepunkte und eine
- Ladeleistung von 3,98 Gigawatt (GW).
Viel bequemer und preiswerter geht es mit der Wallbox zu Hause. Für viele potenzielle Autokäufer:innen stellte die KfW-Förderung für Wallboxen in Kombination mit Solaranlage und -speicher daher einen erheblichen Anreiz zum Umstieg auf die Elektromobilität dar. Für den Herbst 2023 hatte die Bundesregierung eine Neuauflage des Programms in Aussicht gestellt. Leider mussten diese Pläne auf Eis gelegt werden, denn die geplanten 200 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt stehen nicht zur Verfügung. Auch der KfW-Zuschuss 440 für Wallboxen an bestehenden Wohngebäuden ist ausgelaufen.

Engmaschiges Netz an öffentlichen Ladestationen erwünscht: E-Autos zu Hause zu laden mit Förderung aus Bundesmitteln könnte als Zwischenlösung und zur Entlastung des öffentlichen Netzausbaus dienen. (Foto: Joenomias, Pixabay)
Fördermittel für die solare E-Auto-Ladestation zu Hause
Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung sieht für 2024 nur noch folgende Mittel zur Förderung von umweltfreundlicher Elektromobilität vor:
- 500 Millionen Euro zur Unterstützung der Batteriezellfertigung
- 1,92 Milliarden Euro Zuschüsse zur Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur
Die Gelder werden aber nur noch für den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes zur Verfügung stehen.
Gut zu wissen: Trotz bundesweitem Förderstopp kannst du für die Wallbox zu Hause in manchen Bundesländern und Kommunen Förderungen erhalten. Auch die steuerlichen Vorteile der Dienstwagenregelung für Firmenwagen sollen weiter bestehen bleiben.
Letzte Aktualisierung 16.05.2024